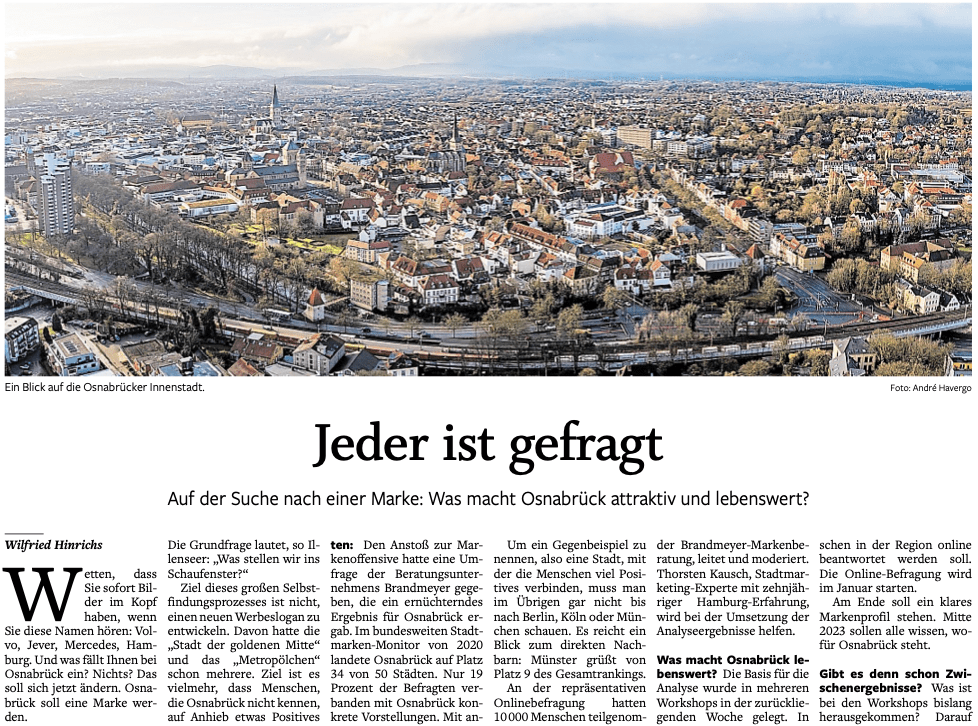INHALT

Stadt für alle, Orte für alle?
Öffentliche Räume in Städten sind Begegnungsstätten, Orte des Austauschs und des gemeinsamen Lebens. Doch was passiert, wenn ein wachsender Teil der Bevölkerung diese Räume nicht mehr nutzen kann? Menschen mit Demenz sind oft von den öffentlichen Räumen ausgeschlossen – nicht, weil sie es wollen, sondern weil die Städte für sie nicht gemacht sind.
Für Kommunen ist das eine Herausforderung, aber auch eine Chance. Denn eine demenzfreundliche Stadt wird für alle lebenswerter. Sie zeigt, wie Gesellschaften soziale Teilhabe, Orientierung und Sicherheit miteinander verbinden können.
Doch wie erreichen Städte und Kommunen Demenzfreundlichkeit? Wie wird eine Stadt zur Stadt für alle?
Kurzfassung:
Wie können Städte so gestaltet werden, dass sie für alle zugänglich sind – auch für Menschen mit Demenz? Mit dem demografischen Wandel wächst diese Herausforderung.
Dominik Lorenz zeigt, warum demenzfreundliche Stadtplanung wichtig ist, welche Lösungen es gibt und wie alle davon profitieren.
Der demografische Wandel – und seine Auswirkungen
Mit dem demografischen Wandel wächst der Anteil älterer Menschen in Deutschland rapide. Bis 2040 wird voraussichtlich fast ein Drittel der Bevölkerung 65 Jahre oder älter sein, und die Zahl der Menschen mit Demenz steigt dementsprechend.
Was zunächst wie ein rein medizinisches oder pflegerisches Problem erscheint, hat enorme Auswirkungen auf unsere Städte: Wenn Menschen mit Demenz aus ihrem gewohnten Umfeld herausgerissen werden – sei es durch unklare Strukturen, fehlende Orientierungshilfen oder mangelnde Sicherheit –, ziehen sie sich zurück. Sie verlieren ihre Autonomie, ihre soziale Teilhabe und oft auch das Vertrauen in die eigene Umgebung.
Für Kommunen bedeutet das nicht nur höhere Kosten in der Pflege, sondern auch den Verlust eines Teils ihrer Stadtgesellschaft. Doch genau hier liegt eine Chance: Eine Stadtplanung, die Menschen mit Demenz einbezieht, schafft Orte, die für alle zugänglich und lebenswert sind.
Was macht einen öffentlichen Raum demenzfreundlich?
Um den öffentlichen Raum für Menschen mit Demenz zugänglich zu machen, reicht Barrierefreiheit allein nicht aus. Vielmehr müssen grundlegende Bedürfnisse berücksichtigt werden – von der Aufenthaltsqualität über Begegnungsmöglichkeiten bis hin zu Orientierung und Sicherheit.
Die Aufenthaltsqualität eines Platzes oder Parks entscheidet, ob Menschen dort Zeit verbringen möchten. Für Menschen mit Demenz sind:
- einladende Sitzgelegenheiten,
- schattige Bereiche und
- beruhigende Elemente wie Grünflächen oder Wasser besonders wichtig.
Öffentliche Räume mit diesen Voraussetzungen bieten nicht nur Entspannung für alle, sondern ermöglichen Menschen mit Demenz, sich sicher und geborgen zu fühlen.

Öffentliche Räume sind für alle da – auch für ältere Menschen in unserer Gesellschaft
Begegnung, Orientierung, Sicherheit: Grundvoraussetzungen der Teilhabe für Menschen mit Demenz
Begegnung ist der Schlüssel zur sozialen Teilhabe
Öffentliche Räume, die bewusst als Treffpunkte gestaltet sind, fördern das Miteinander und verhindern Isolation. Gemeinschaftsgärten, Nachbarschaftszentren oder gut gestaltete Plätze sind Beispiele, wie Begegnung im öffentlichen Raum aktiv gefördert werden kann.
Orientierung dank klarer Strukturen
Auch Orientierung spielt eine zentrale Rolle: Menschen mit Demenz verlieren oft die Fähigkeit, sich in komplexen Umgebungen zurechtzufinden. Klare Strukturen, wiedererkennbare Landmarks und deutliche Beschilderungen schaffen Orientierung und reduzieren Stress.
Sicherheit stärkt Eigenständigkeit
Sicherheit ist für jede Stadt und für jedes Mitglied einer Stadt wichtig: Gut beleuchtete Wege, barrierefreie Zugänge und ruhige Rückzugsorte machen den öffentlichen Raum zugänglich und vertrauenswürdig. Eine Verkehrsberuhigung kann ebenfalls dazu beitragen, dass sich Menschen sicher bewegen können.
Für Menschen mit Demenz ist Sicherheit oft ein entscheidender Faktor, der darüber entscheidet, ob sie den öffentlichen Raum nutzen können oder nicht. Ein Umfeld, das Schutz bietet und gleichzeitig Bewegungsfreiheit ermöglicht, schafft Vertrauen und stärkt die Eigenständigkeit.
Praxisbeispiel: Das Fliedner-Dorf in Mühlheim
Das Fliedner-Dorf in Mühlheim an der Ruhr (Nordrhein-Westfalen) zeigt, wie die Ansätze einer demenzfreundlichen Umgebung umgesetzt werden können: Die Anlage, die von der Theodor Fliedner Stiftung betrieben wird, ist wie eine kleine Stadt gestaltet. Es gibt einen Bäcker, einen Supermarkt und normale Straßen – Orte, die das tägliche Leben abbilden.
Grundprinzipien des Fliedner-Dorfs: Inklusion und Bewegungsfreiheit
Ein entscheidendes Prinzip des Fliedner-Dorfs ist der Verzicht auf Zäune oder Mauern, die Menschen mit Demenz einschränken oder isolieren würden. Stattdessen können sich Betroffene frei bewegen und ein Leben führen, das möglichst wenig Einschränkungen beinhaltet. Dieser Ansatz setzt ein starkes Zeichen gegen Freiheitsentzug und zeigt, dass auch Menschen mit Demenz Teil eines offenen und funktionierenden Gemeinwesens sein können.
Das Fliedner-Dorf verfolgt einen stark inklusiven Ansatz: Menschen mit und ohne Behinderung können hier gleichwertig zusammenwohnen. Die Häuser werden entweder von Menschen mit einer Behinderung oder einem Pflegegrad oder von Menschen ohne Einschränkung bewohnt. Ein Großteil der Menschen mit einer Einschränkung ist dabei von Demenz betroffen.
Diese Vielfalt fördert nicht nur die Inklusion, sondern sorgt auch für ein gegenseitiges Verständnis und eine respektvolle Gemeinschaft, in der jede Person ihren Platz hat.
Demenzfreundliches Fliedner-Dorf: Ortswechsel bleibt ein Problem
Speziell für Menschen mit Demenz wurden ein Sinnesgarten, Gemeinschaftsgärten und ein Leitsystem mit Orientierungssäulen geschaffen, die den Alltag erleichtern und den Betroffenen mehr Sicherheit geben.
Doch es gibt eine entscheidende Einschränkung: Das Fliedner-Dorf ist auf der „grünen Wiese“ entstanden und bleibt von der Grundstruktur eine Pflegeeinrichtung. Damit Menschen dorthin ziehen können, müssen sie ihr gewohntes Umfeld verlassen – ein Einschnitt, der den Krankheitsverlauf beschleunigen kann.
Demenzfreie Stadt: Bestehende Quartiere inklusiv gestalten
Statt neue Einrichtungen zu schaffen, sollten Städte den Fokus darauf legen, bestehende Quartiere inklusiv umzugestalten. Menschen mit Demenz sollten so lange wie möglich in ihrem gewohnten Umfeld bleiben können. Dafür braucht es klare Orientierungshilfen, sichere Wege, Rückzugsorte und Begegnungsräume direkt in den Wohnvierteln.
Diese Maßnahmen ermöglichen nicht nur den Verbleib in der Heimat, sondern stärken auch die soziale Bindung in den Nachbarschaften.
Inklusive Stadtplanung:
Inklusive Stadtplanung zielt darauf ab, Städte so zu gestalten, dass sie für alle Menschen zugänglich und nutzbar sind – unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung oder sozialem Status. Dabei werden Barrierefreiheit, soziale Gerechtigkeit und die Bedürfnisse marginalisierter Gruppen in den Planungsprozess integriert, um eine nachhaltige und gerechte Stadtentwicklung zu fördern.
In Bezug auf Demenzfreundlichkeit bedeutet inklusive Stadtplanung, allen Menschen das Leben in der eigenen Nachbarschaft zu erleichtern, statt Menschen in spezialisierte Einrichtungen zu verlagern.
Von demenzfreundlichen Räumen profitieren alle
Eine demenzfreundliche Stadt zu schaffen, ist keine Maßnahme, die nur einer speziellen Gruppe zugutekommt. Vielmehr profitieren alle Stadtbewohner:innen und Besucher:innen davon – ältere Menschen, Familien mit Kindern, Touristen und die lokale Wirtschaft:
- Ein öffentlicher Raum mit hoher Aufenthaltsqualität wird zum Magneten – für Wochenmärkte, Spaziergänge oder kulturelle Veranstaltungen.
- Begegnungsorte stärken den sozialen Zusammenhalt und schaffen ein positives Image der Stadt.
- Klare Orientierungshilfen helfen nicht nur Menschen mit Demenz, sondern auch Besucher:innen oder neuen Bewohner:innen, sich zurechtzufinden.
- Eine sichere Umgebung lädt dazu ein, sich frei zu bewegen, egal ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Rollstuhl.
„Für Kommunen liegt der Vorteil auf der Hand: Demenzfreundliche Räume sind eine Investition in die Zukunft. Sie stärken die Attraktivität der Stadt, fördern die soziale Teilhabe und reduzieren langfristig Kosten, etwa durch den Erhalt von Selbstständigkeit und Eigenverantwortung älterer Menschen.“

Zurück in die Mitte der Gesellschaft: Auch ältere Menschen haben Anspruch auf ihren Platz im öffentlichen Raum
Ein Blick in die Zukunft von Stadt: Inklusiv gleich zukunftsfähig?
Eine Stadt, die Menschen mit Demenz berücksichtigt, ist eine Stadt, die versteht, dass Lebensqualität für alle zugänglich sein muss. Denn in der inklusiven Stadtentwicklung geht es nicht nur darum, Barrieren zu beseitigen, sondern darum, Räume zu schaffen, die Sicherheit bieten sowie Begegnung ermöglichen.
Für Kommunen ist das eine große Verantwortung – aber auch eine Chance. Indem sie Maßnahmen für eine demenzfreundlichere Stadt ergreifen, setzen sie ein Zeichen: für eine Stadt, die niemanden zurücklässt, und für eine Zukunft, in der Lebensqualität und Inklusion Hand in Hand gehen.
„Jetzt ist die Zeit, die Chancen der inklusiven Stadtentwicklung zu nutzen. Städte, die heute handeln, werden morgen lebenswerter und zukunftsfähiger sein.“
Bild-Credit: Unsplash.com
Dominik Lorenz
ist Projektassistent bei der Stadtmanufaktur. In seiner Masterarbeit beschäftigte er sich intensiv mit dem Thema „Demenz in der Stadt“